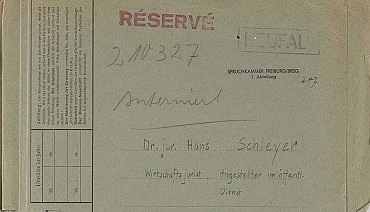Auch ein Opfer des NSU. Vorabveröffentlichung aus RECHTS.GESCHEHEN Nr. 7

Das CT-Gerät arbeitet ruhig vor sich hin. Schicht für Schicht, bei den Füßen beginnend, erfasst es den ganzen Körper. Peter F. schaut auf den Bildschirm, verfolgt wie sich langsam vor ihm der Mensch aufbaut, der im Raum nebenan liegt. Eine Frau, Kollegin. Sie ist tot. Erschossen vor wenigen Stunden auf der Theresienwiese in Heilbronn. Projektil und Hülsen wurden am Tatort sichergestellt, jetzt will Peter F., leitender Kriminaltechniker der "Soko Parkplatz" endlich sehen, wie die Flugbahn der Kugel war. Das ist ein wichtiges Puzzlestück, um später zu rekonstruieren, wie die Tat stattgefunden hat. Die Körnchen der Zeit, sie rieseln in diesen Minuten langsamer als jemals zuvor durch die Sanduhr. Endlich bauen sich die letzten Schichten ihres Kopfes auf und Peter F. sieht, worauf er seit den Füßen wartet. Die Kugel trat vier Zentimeter oberhalb des linken oberen Ohrmuschelansatzes ein, bahnte sich ihren Weg durch den Kopf und trat drei Zentimeter rechts des äußeren Lidwinkels wieder aus – ein Kopfdurchschuss. Michèle Kiesewetter war sofort tot. Ihr Mord, der letzte in einer ganzen Serie der Terrorgruppe NSU. Sechzehn Jahre ist das her.
Es regnet, kalt ist es und grau, der Himmel und die Miene derer, die mit eingezogenem Kopf über die Kreuzung eilen. Peter F. sitzt im Auto, schaut den Eilenden nach, zeigt auf die große Uhr, die auf einer Verkehrsinsel steht. Sie sei nach der Atomuhr in Braunschweig gestellt, genauer geht es also nicht, erzählt er. Am 25.04.2007, ein Mittwoch, stand hier an der roten Ampel eine Frau und blickte im gleichen Moment auf diese Uhr, in der sie Schussgeräusche hörte. Es war 13:58 Uhr, wird sie später aussagen. Peter F. setzt den Blinker, biegt nach links ab. Schotter unter den Autoreifen, der Schalthebel auf "P" – Ankunft Theresienwiese. Ein großer Platz in Heilbronn, der den gleichen Namen trägt, wie der in München. Feste werden auch hier gefeiert. Gemordet wurde an beiden Orten. Die Täter, Rechtsextreme – hier und dort. Thesen über Parallelen zwischen dem "Oktoberfestattentat" im September 1980 auf der Münchener Theresienwiese und dem NSU-Mord auf der Heilbronner Theresienwiese gibt es, Peter F. kennt sie und all die anderen Theorien. Jeder Experte hat seine eigene. Am Ende ist es mit dieser Wahrheit aber wie mit einer Schneeflocke, sobald man denkt, man hätte sie gefangen, ist sie nur noch Wasser.
Peter F. bückt sich, fährt mit den Fingern über die Mauer des Trafohäuschens, das auf der Theresienwiese steht. Es ist nicht das erste Mal, dass er das tut. "Hier war eine Kerbe, dort ist das Projektil abgeprallt und dann in den Schacht gefallen, sagt er und zeigt auf das löchrige Metallgitter, das den Blick in die Tiefe freigibt. Jetzt ist die Kerbe weg. Achselzucken, vielleicht wurde die Mauer ausgebessert und überstrichen. Das ist der Tatort. Hier parkten die beiden Polizisten Michèle Kiesewetter und Martin A. ihren Streifenwagen, um Pause zu machen. Hier sah Peter F. die Kollegin in ihrer Uniform leblos am Boden liegen. "Eine von uns", sagt er. "Eine von uns", wiederholt er. Auch den Kollegen Martin A. traf eine Kugel in den Kopf, schwerverletzt wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er überlebte. Wie das Leben für ihn heute ist, weiß Peter F. nicht genau. Rückstände des Projektils sollen noch immer in seinem Kopf stecken, sie werden nicht die einzige bleibende Erinnerung sein, die er hat.
Man nennt sie Mahnmal, Gedenktafel, Erinnerungsstätte. Bezeichnungen gibt es viele für die leblosen Zeitzeugen, die an das Grauen der Vergangenheit erinnern. Erhobene Zeigefinger in Stein und Metall, damit auch in der Zukunft keiner vergisst, was längst Geschichte wurde. "Historisierung" nennt Peter F. es, wenn er davon erzählt, dass in den ersten Jahren am Jahrestag nach dem Mord "an der Kollegin" noch der ganze Platz vor dem Gedenkstein am Rand der Theresienwiese voll mit Menschen stand, heute streckt er eine Hand in die Höhe, um zu zeigen, wie viele noch vor Ort kommen, um sich zu erinnern.
Der Mord an der jungen Polizistin hat auch Peter F. das Leben gekostet, wenn Leben mehr ist als nur das Gegenteil von Tod. Posttraumatische Belastungsstörung lautet seine Diagnose. Seit Jahren ist er nicht mehr in der Lage zu arbeiten, war Monate lang in Therapie, hat Skills antrainiert bekommen, die helfen sollen, wenn sie sich zeigt, die Angst, wenn sie kommen, die Flashbacks. "Es ist alles hier drin", sagt Peter F. und zeigt auf seinen Kopf. Deshalb kann er auch an den schönsten Orten der Welt sein, mit dem Menschen, den er am meisten liebt, in ihm kann es von jetzt auf gleich dunkel werden. "Ich habe das Problem immer dabei", sagt er. Den Moment, der das alles auslöste, kennt er. Viele Male hat er ihn mit unterschiedlichen Psychologen durchgekaut und analysiert. Doch das ändert nichts, das Gefühl noch immer nicht abgestumpft. Die Bilder jetzt wieder da. Deshalb bricht ihm an dieser Stelle der Geschichte die Stimme weg. Er wendet den Blick ab – kurz auftauchen, Luft holen, um nicht in den Wellen an Emotionen zu ertrinken. Dann erzählt er weiter. Zwei Tage sind seit dem Mord vergangen. Er und sein Kollege fahren mit dem Fahrstuhl hoch in den zweiten Stock des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Da liegt sie "die Kollegin". Peter F. spricht viel "von der Kollegin" und wenig von "Michèle Kiesewetter". Je länger man ihm zuhört, desto mehr fällt es einem auf.
In der Pathologie ist es taghell – grelles Neonlicht für die Toten, deren Sterben nochmal genau beleuchtet werden muss. Nur ein Tisch ist belegt. Michèle Kiesewetter liegt dort. Peter F. hatte Stunden vorher angerufen und darum gebeten, die junge Polizistin für die nachträgliche Spurensicherung nochmal dorthin zu bringen. Die Kriminaltechniker Peter F. und sein "Co-Pilot", wie er den Kollegen nennt, weil sie mehr gemeinsam haben als nur den gleichen Job, beginnen mit der Routine: sichern, eintüten, beschriften. Alles geht seinen Gang, den gewohnten heute aber nicht. Peter F. schaut sie an "die Michèle", "die Kollegin", erschossen in der gleichen Uniform, wie er sie früher trug. "Identifizierung mit dem Opfer", werden die Psychologen in der Therapie später diesen Moment nennen. Schlüsselmoment, das, was jetzt kommt. Peter F. beginnt ein Gespräch mit der Kollegin: "von mir zu ihr", sagt der Lebende über seine Worte zu der Toten. "Ich verspreche dir, dass ich alles tun werde, um diese Dreckssäcke zu bekommen." Er schaut auf und fragt: "Oder?", in Richtung seines Co-Piloten. Der Co-Pilot nickt. Damit war es besiegelt. Das Versprechen lange sein Antrieb, die Motivation in seiner täglichen Ermittlungsarbeit. Die Aufklärung des Mordes an der Kollegin wurde zunehmend zu seinem Lebensinhalt. Peter F. hat für das, was der Fall mit ihm machte, eine Analogie gefunden. Er erzählt von der Verfilmung des Romans von Friedrich Dürrenmatt "Das Versprechen" mit Jack Nicholson. Die Hauptfigur, Jack Black, ein pensionierter Kriminalbeamter, verliert sich zunehmend in der Aufklärung eines Mordfalls an einem kleinen Mädchen. Der Sinn seines Lebens besteht nur noch darin, den Mörder zu finden. Es gelingt ihm nicht. Der Mörder stirbt bei einem Autounfall, das weiß aber nur der Zuschauer. Jack Black erfährt es nie. In der Schlussszene sieht man einen ziemlich fertigen alten Mann vor einer Tankstelle sitzen, der Selbstgespräche führt und Schnaps aus der Flasche trinkt.
Als das Landeskriminalamt 2009 die Ermittlungsarbeiten der "Soko Parkplatz" übernahm und damit Peter F. seine Arbeit am Fall beenden musste, leerte sich der Inhalt seines Lebens. Peter F. sollte aus dem Ausnahmezustand zurückkehren in die alltägliche Polizeiarbeit. Doch wirklich an kam er dort nie mehr. "Neben dem Mord an der Kollegin kamen mir die anderen Fälle unwichtig vor, nichts hatte mehr Bedeutung", sagt Peter F. über das tiefe Loch, in das er fiel und in dem er jahrelang blieb.
Für Peter F. ist das Versprechen, das er der toten Kollegin gab und nie einlösen konnte: "Die schwerste Enttäuschung an mir selbst". Irgendwann wurde Peter F. krankgeschrieben, war in Therapie, kehrte wieder zurück in den Dienst, war wieder krankgeschrieben, wieder in Therapie und kehrte schließlich nie mehr in den Polizeidienst zurück. Stattdessen erfüllten er und seine Frau sich einen langen Traum und kauften ein Haus in der Provence. Wer an dieser Stelle ein Happy End erwartet, wird an selbiger enttäuscht. Das Problem zog mit Peter F. in die Provence. Heute erinnern Bilder an der Wand in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe von Heilbronn an die Zeit in Südfrankreich.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland fing Peter F. an, ein Dossier anzufertigen. Er wollte "etwas über den NSU" schreiben. Inzwischen hat "etwas" über 100.000 Seiten und reicht bis in die heutige Zeit. Peter F. hat die jahrelange intensive Arbeit an dem Dossier lange vor sich selbst gerechtfertigt, in dem er sagte, es wäre ein Prozess des Abschließens, ein "sich von der Seele schreiben". Auf die Frage, ob es nicht eher ein "am Leben halten, ein nicht loslassen können" ist, nickt er und sagt: "Auch, ja." Das letzte Kapitel seines Dossiers lautet: "nach dem NSU ist vor dem NSU". "Ein Fass ohne Boden", wie er selbst erkannt hat. Ende März dieses Jahres schrieb er in einer Mail, dass sein ursprüngliches Ziel etwas über den NSU zu schreiben intensiver ausfiel als gedacht. "Ein thematisches Ausufern wäre möglich, aber nicht zielführend", hat er längst erkannt.
Peter F. hätte wie Jack Black aus "Das Versprechen" enden können. Der NSU hätte ihn auch noch den Rest seiner Lebenszeit kosten können – Hätte, hätte... Peter F. ist heute Anfang sechzig und lebt nicht mehr in der Vergangenheit. Die Jahrzehnte lange Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus hat aus ihm einen Experten gemacht, ohne dass er es gemerkt hat. Er engagiert sich gegen rechte Gewalt. Das will er auch in Zukunft machen, denn in die schaut er jetzt.
Linda Roth, Redaktionsteam RECHTS.GESCHEHEN